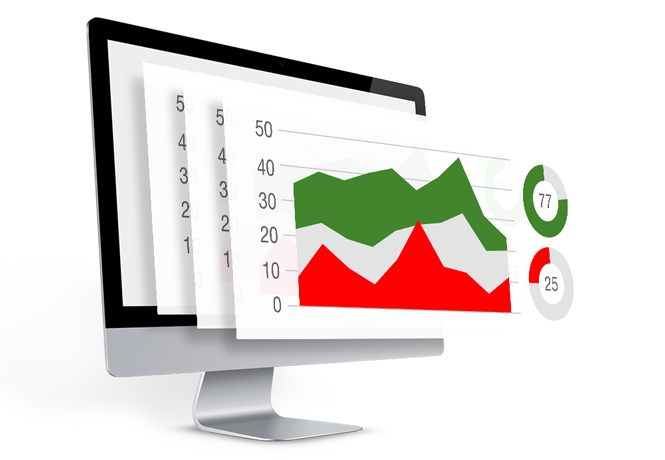AMA-Sommerertragserhebung: Erträge übertreffen Vorjahr
20.11.2020 Hektarertrag von Wintergerste und Roggen auf Rekordniveau, bester Weichweizenertrag seit vier Jahren, Ergebnisse von Raps erneut enttäuschend.Die diesjährige Sommerertragserhebung der AMA liegt COVID19-bedingt später als gewohnt vor. Die Ergebnisse sind dennoch einer näheren Betrachtung wert:
Weichweizen liegt mit 62,2 dt/ha über den Ergebnissen der Vorjahre, aber weiterhin unter dem Rekordwert aus 2016. Im Hauptanbaugebiet Niederösterreich wurde ein rein konventioneller Hektarertrag von 63,3 dt/ha erreicht, welcher den zweithöchsten Wert in der Geschichte des Bundeslandes (seit 1999) einnimmt. Vergleicht man das mit konventionellen und biologischen Erträgen gewichtete Gesamtergebnis des Bundeslandes von 59,6 dt/ha, so ordnet sich der Hektarertrag nur mehr auf Platz Drei (nach 2011 60 dt/ha) in der historischen Betrachtung ein. Oberösterreich schafft mit einem (konv. und biol.) gewichteten Ertrag von 76,2 dt/ha das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Bundeslandes (2014: 81,4 dt/ha).
Roggen erreicht durch gute Vegetationsbedingungen und züchterischen Fortschritt (Hybridzüchtung) das bisher historisch beste Ertragsergebnis von 51,3 dt/ha. Dies spiegelte sich auch im Hauptanbaugebiet Niederösterreich mit 51,2 dt/ha wider.
Wintergerste erreicht – nach dem Rekordwert des Ertrages im Vorjahr – ein noch einmal besseres Ergebnis von 69,2 dt/ha. Diese auf einer ständig wachsenden Fläche angebaute Kultur kann als zuerst geerntete Getreideart die Winterfeuchte besser als andere Getreidearten ausnützen. Der Ertragsanstieg basiert auf eine Erhöhung in Niederösterreich, während Oberösterreich das gute Ertragsniveau des Vorjahres nahezu halten kann.
Triticale erzielt mit 58,3 dt/ha das drittbeste Ergebnis nach 2016 (58,8 dt/ha) und 2014 (59 dt/ha), wobei sich der rein konventionelle Hektarertrag von 64,7 dt/ha durch den hohen Bioanteil an der Fläche (26 %) deutlich vom Gesamtergebnis abhebt.
Die Sommergetreidearten Hafer (42 dt/ha), Sommergerste (49 dt/ha) und Sommerhartweizen litten unter der Frühjahrstrockenheit im April, konnten jedoch eine Steigerung zu den trockenen Vorjahren erzielen.
Enttäuschend sind erneut die Hektarerträge von Ölraps. Der Ertrag von 31,5 dt/ha liegt zwar über den trockenen Vorjahren, aber ist als unterdurchschnittlich einzuordnen. Trockenheit und Schädlingsproblem im Herbst des Vorjahres sowie im Frühjahr führten zu diesem Ergebnis. Damit stellten sich die Bedingungen für diese für die Inlandsversorgung bedeutende Ölsaat als negativ heraus, weshalb mit einer Fortsetzung des negativen Flächentrends seit 2014 gerechnet wird. Die Anbaufläche wurde seit damals um 40 % reduziert.
Das vierte Jahr in Folge wurden von der AMA die biologischen Erträge getrennt von den konventionellen Erträgen erhoben. Die Ertragsunterschiede korrelieren negativ mit den Bio-Anteilen an der Gesamtfläche je Kultur. Das bedeutet, dass die Ertragsunterschiede bei Körnerleguminosen und Dinkel gering ausfallen und daher ein hoher Anteil der Fläche biologisch bewirtschaftet wird. Bei Weichweizen sind die Unterschiede mit rund einem Drittel im Mittelfeld, während Wintergerste auf den konventionellen Betrieben wesentlich besser abschneidet, wodurch der geringe Bio-Anteil an der Fläche erklärt werden kann. Ölraps weist als besonders intensive Kultur die größten Unterschiede (zwei Drittel) auf, wodurch der geringe Bio-Anteil an der Fläche von lediglich 0,7 % erklärt werden kann.
DI Herz, 20.11.2020